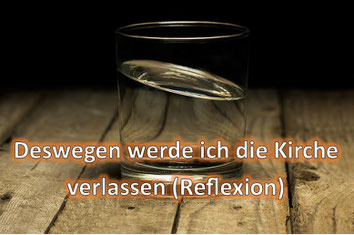Gedanken...
... im Zusammenhang mit Glauben, Gemeindeaufbau und Sonstiges. (Dieser Bereich wird nach und nach ergänzt.)
Ein Dekret voller Widersprüche – Gedanken zur psychologischen Eignungsprüfung für Seelsorger
Die Schweizer Diözesanbischöfe haben kürzlich ein neues Dekret erlassen: Zukünftige Seelsorgerinnen und Seelsorger müssen eine mehrstufige psychologische Eignungsprüfung durchlaufen, bevor sie für den kirchlichen Dienst zugelassen werden. Auf den ersten Blick scheint das eine vernünftige Maßnahme zur Qualitätssicherung zu sein. Doch bei genauerem Hinsehen offenbaren sich schwerwiegende Widersprüche, rechtsstaatliche Bedenken und eine bedenkliche Ignoranz gegenüber der geistlichen Dimension des Berufs.
Keine Rekursmöglichkeit
Eine der gravierendsten Bestimmungen des Dekrets ist Punkt 7: Es gibt keine Möglichkeit, gegen das Ergebnis dieser Prüfung Einspruch zu erheben. Das bedeutet, dass eine einzelne Bewertung über die gesamte seelsorgliche Zukunft einer Person entscheiden kann – ohne Chance auf Überprüfung oder Korrektur.
Eine solche Regelung widerspricht jeder rechtsstaatlichen Grundordnung. Warum wird ein so fundamentales Prinzip – das Recht auf eine zweite Meinung, auf Transparenz und eine faire Anhörung – in der Kirche einfach außer Kraft gesetzt?
Fehlentscheidungen sind menschlich. Gerade psychologische Gutachten sind keine exakten wissenschaftlichen Diagnosen, sondern immer interpretationsabhängig. Dass es dennoch keine Überprüfungsmöglichkeit gibt, wirft die Frage auf: Geht es hier wirklich um Qualitätssicherung – oder um Kontrolle und Machtausübung?
Ein Widerspruch zum eigenen Verhaltenskodex
Besonders auffällig ist der eklatante Widerspruch zwischen diesem Dekret und dem kürzlich veröffentlichten Verhaltenskodex, den die Churer Bistumsleitung mit großer Öffentlichkeitswirksamkeit unterzeichnet hat. Darin heißt es unter Ziffer 4.b.3:
„Ich ... fordere weder Gehorsam noch Unterwerfung ein.“
Aber genau das passiert hier. Wer sich dem psychologischen Gutachten unterzieht, hat sich dem Urteil der Evaluationskommission bedingungslos zu beugen – ohne Rekurs, ohne Möglichkeit zur Verteidigung. Wenn das keine erzwungene Unterwerfung ist, was dann?
Dieser Widerspruch ist nicht nur ein theoretisches Problem, sondern ein handfester Glaubwürdigkeitsverlust. Wie kann man von einem Verhaltenskodex sprechen, wenn neue Regeln ihn sofort wieder aushebeln?
Psychologische Tests statt Berufung – die spirituelle Dimension fehlt
Ein weiteres großes Problem dieses Dekrets ist, dass es sich ausschließlich auf psychologische und forensische Methoden stützt, aber den Glauben als entscheidenden Faktor völlig ignoriert.
Ein Mensch mit einer lebendigen, echten Beziehung zu Jesus Christus vergreift sich nicht an Schutzbefohlenen. Wer seinen seelsorglichen Dienst aus einem tiefen Glauben heraus lebt, stellt sich in Verantwortung vor Gott – eine Dimension, die kein psychologisches Assessment erfassen kann.
Doch im gesamten Dekret gibt es keinen einzigen Hinweis darauf, dass die spirituelle Reife eines Kandidaten geprüft wird.
- Warum wird die Glaubensbeziehung nicht als entscheidendes Kriterium herangezogen?
- Ist es nicht gerade die Christusnachfolge, die einen Seelsorger erst zu dem macht, was er ist?
- Wie kann ein Verfahren, das den eigentlichen Kern einer Berufung ignoriert, ernsthaft beanspruchen, über Eignung zu entscheiden?
Ein solches Vorgehen zeigt eine besorgniserregende Verweltlichung der Kirche. Anstatt geistliche Unterscheidung zu praktizieren, vertraut man auf psychologische Checklisten. Damit wird die Tür geöffnet für oberflächliche Beurteilungen, die das Wesentliche aus den Augen verlieren.
Transparenz, Datenschutz und Missbrauchsrisiken
Das Verfahren bleibt auch in anderen Punkten bedenklich intransparent:
- Wer legt die „Basiskompetenzen“ fest, nach denen beurteilt wird?
- Wer sind die Evaluations-Experten, und wer überprüft ihre Entscheidungen?
- Wie wird verhindert, dass "unliebsame" Kandidaten durch dieses Verfahren ausgeschaltet werden?
Hinzu kommt ein enormes Datenschutzrisiko. Psychologische Gutachten sind hochsensible Daten – doch das Dekret schweigt sich darüber aus, wer Zugang zu den Ergebnissen hat, wie lange sie gespeichert werden und ob die Kandidaten sie überhaupt einsehen dürfen.
Warum nur Seelsorger und nicht auch Religionspädagogen?
Wenn das Ziel des Dekrets der Schutz Dritter ist – warum gilt es dann nur für Seelsorger und Priesteramtskandidaten? Auch Religionspädagoginnen und Religionspädagogen arbeiten intensiv mit Gläubigen, insbesondere Jugendlichen.
- Warum wurde diese Berufsgruppe nicht einbezogen?
- Ist das Dekret also gar nicht primär auf den Schutz ausgerichtet, sondern eher ein Kontrollinstrument für künftige Priester und Pastoralassistenten?
Gerade in der Jugendarbeit zeigt sich ein weiteres Problem: Seelsorge lebt nicht nur von festen Mitarbeitern, sondern oft von ehrenamtlicher Unterstützung.
- Viele kirchliche Angebote wie Freizeiten, Jugendwochen oder Kinderlager wären ohne die punktuelle Mithilfe von Ehrenamtlichen gar nicht möglich.
- Wenn die Kirche ihre Anforderungen auf hauptamtliche Theologen beschränkt, ignoriert sie die Realität der kirchlichen Jugendarbeit, in der viele Nicht-Theologen eine wesentliche Rolle spielen.
Sollte das Ziel wirklich ein sicherer und guter Umgang mit jungen Menschen sein, dann müsste man sich fragen:
- Warum werden dann nicht alle einbezogen, die mit Jugendlichen arbeiten – auch Ehrenamtliche?
- Oder geht es gar nicht primär um den Schutz, sondern um eine neue Form von Kontrolle für zukünftige Seelsorger?
Fazit: Eine Maßnahme voller Widersprüche
Das Dekret zur psychologischen Eignungsprüfung offenbart eine tiefe Orientierungslosigkeit innerhalb der Kirche:
- Einerseits unterzeichnen die Bistumsleitung öffentlichkeitswirksam einen Verhaltenskodex, der Machtmissbrauch verhindern soll – und erlassen dann Regeln, die genau das tun.
- Einerseits betont die Kirche die Bedeutung der Berufung – und misst die Eignung für den seelsorglichen Dienst dann nur an psychologischen Standards.
- Einerseits soll das Verfahren dem Schutz Dritter dienen – aber es wird nicht einmal die Frage gestellt, ob jemand wirklich aus seinem Glauben heraus lebt.
- Und schließlich wird ein Prüfverfahren für Seelsorger eingeführt, ohne zu bedenken, dass die kirchliche Arbeit längst nicht nur von ihnen abhängt.
Wenn dieses Dekret tatsächlich um Qualitätssicherung bemüht wäre, müsste es sich zuerst mit seinen eigenen Widersprüchen auseinandersetzen. Solange es das nicht tut, bleibt es ein fragwürdiges Instrument, das die Kirche nicht stärkt, sondern weiter verunsichert.
Schlussbemerkung: Die Gefahr von Parallelwelten
Pfarreien stehen heute vor einer großen Herausforderung: Sie brauchen dringend gutes Personal. Doch wenn das neue Eignungsverfahren zu einem bürokratischen Hemmschuh wird, könnte es zu einer ungewollten Entwicklung führen: Pfarreien könnten anfangen, ihre eigenen Wege zu gehen.
Was wäre, wenn Pfarreien ihre Mitarbeiter einfach selbst auswählen, sie unabhängig bei niedergelassenen Psychiatern testen lassen und sie dann direkt anstellen – am Bistum vorbei ohne bischöfliche Missio? Dieses Vorgehen wird heute bereits in nicht wenigen Pfarreien der Schweiz so gehandhabt und könnte weitere Verstärkung erfahren.
Die Gefahr besteht, dass sich Parallelstrukturen entwickeln, weil Gemeinden pragmatisch handeln müssen, um ihre seelsorglichen Aufgaben zu erfüllen. Anstatt ein funktionierendes System zu schaffen, könnte dieses Dekret dazu beitragen, dass sich Gemeinden und Bistum immer weiter voneinander entfernen.
Letztlich stellt sich die Frage: Wird mit diesem Dekret wirklich das seelsorgliche Wohl der Kirche gefördert – oder entstehen am Ende nur neue Probleme, die das kirchliche Leben zusätzlich erschweren?
01.04.2025
Zum Artikel von Niklas Herzog auf SwissCath:
"Churer Verhaltenskodex: Es geht auch anders"

Der Artikel vergleicht die Verhaltenskodizes der Diözesen Chur und Sitten und hebt deren wesentliche Unterschiede hervor.
Der Churer Kodex (2022) ist mit 29 Seiten deutlich umfangreicher als der Sittener (2025) mit 9 Seiten. Dies liegt nicht nur an zahlreichen Illustrationen und Zitaten, sondern auch an einer intensiven Fokussierung auf das Thema „Macht“. Verfasst wurde er von Karin Iten und Stefan Loppacher, die beide umstritten sind: Loppacher trat später aus der Kirche aus, während Iten für ihre Sichtweise auf sexuelle Entwicklung von Jugendlichen kritisiert wurde. Beide gründeten später den Verein „MachtRaum“, was zu Interessenkonflikten führt, da Loppacher weiterhin eine kirchliche Missbrauchsstelle leitet.
Der Churer Kodex wird als belehrend, überkontrollierend und antiklerikal empfunden. Er enthält viele Formulierungen in der Ich-Form und sieht Macht ausschließlich negativ. Zudem wird kritisiert, dass Beichtstühle als unangemessen deklariert werden und der Kodex eine verpflichtende Unterschrift fordert, deren Verweigerung als mangelnde Reflexionsfähigkeit gewertet wird.
Im Gegensatz dazu wird der Sittener Kodex als sachlich, prägnant und zielführend beschrieben. Er konzentriert sich auf eine wirkliche Präventionskultur und listet klare Verhaltensregeln auf, die den Schutz der Würde, Integrität und Selbstbestimmung fördern. Er wurde von einer unabhängigen Präventionskommission erstellt und vom Bischof sowie Bischofsrat genehmigt.
Fazit: Der Sittener Verhaltenskodex gilt als vorbildlich, während der Churer Kodex als überladen und ideologisch beeinflusst kritisiert wird.
Meine Gedanken
Der Artikel von Niklas Herzog zeigt eindrücklich die Schwächen des Churer Verhaltenskodex auf. Neben seiner ausufernden Länge und der übermäßigen Fokussierung auf Macht offenbart er gravierende handwerkliche Mängel, die eine unreflektierte Unterschrift unmöglich machen.
Besonders problematisch ist die Klausel unter Ziffer 4.b.3: „Ich fordere weder Gehorsam noch Unterwerfung ein.“ Damit würde jedem Vorgesetzten (ob Kirchenrat, Pfarrer oder Gemeindeleiter) de facto die Autorität über seine Mitarbeiter entzogen – ein Widerspruch in sich. Es entsteht ein Zirkelbezug: Der Bischof verlangt Gehorsam, indem er die Unterschrift unter den Kodex fordert, hat aber gleichzeitig durch seine eigene Unterschrift bereits auf das Einfordern von Gehorsam verzichtet. Eine derartige Regelung wäre in der weltlichen Rechtsprechung wohl kaum haltbar, da sie fundamentalen juristischen und logischen Prinzipien widerspricht.
„Wo ein heiliger Priester ist, gibt es ein tiefes und spirituelles Leben“

Bischof Fernández von Córdoba betont in seinem Fastenhirtenbrief die zentrale Bedeutung des Amtspriestertums für die Kirche und die Dringlichkeit, neue Berufungen zu fördern. Er erinnert daran, dass ohne Priester keine Kirche existieren kann und verweist auf die Lehren des Zweiten Vatikanischen Konzils zur apostolischen Sukzession und zur Eucharistie.
Am kommenden Sonntag werden die Gläubigen des Bistums über das Priesterseminar und die Priesterberufungen nachdenken und beten. Das Bistum feiert den Seminartag 2025 unter dem Motto „Sämann der Hoffnung“, passend zum Jubiläumsjahr „Pilger der Hoffnung“.
Bischof Fernández äußert seine Besorgnis über den Priestermangel und die Überlastung der Priester in der Diözese. Er betont den dringenden Bedarf an neuen Priestern, die sowohl den örtlichen Gemeinden als auch im Missionseinsatz dienen. Er dankt Gott für die Seminaristen im Seminar „San Pelagio“ und „Redemptoris Mater“ und erinnert an das emotionale Treffen mit Papst Franziskus.
Die Förderung von Berufungen sei eine Aufgabe der gesamten Gemeinschaft, insbesondere der Familien und Priester. Wo es einen Priester gibt, gibt es christliches Leben, und wo es einen heiligen Priester gibt, gibt es ein tiefes und spirituelles Leben. Bischof Fernández lädt die Diözese ein, für Priester zu beten und die Entstehung neuer Berufungen zu unterstützen.
14.03.2025
Hier sind einige konkrete Schritte, für die Pfarreien:
- Gebet und Unterstützung: Regelmäßiges Gebet für neue Berufungen und Unterstützung derjenigen, die einen Ruf verspüren.
- Gemeinschaft stärken: Eine starke Gemeinschaft kann junge Menschen inspirieren, den Weg des Priestertums zu wählen.
- Familien einbeziehen: Familien ermutigen, die Berufungen ihrer Kinder zu unterstützen und zu fördern.
- Veranstaltungen und Programme: Organisation von Veranstaltungen und Programmen, die das Bewusstsein für die Bedeutung des Priestertums schärfen.
- Vorbild sein: Priester und Gemeindemitglieder sollten als Vorbilder dienen und die Schönheit und Wichtigkeit des Priestertums vorleben.
Die Zukunft der Kirche in Europa: Überleben in missionarischen Gemeinschaften
Hier finden Sie den Kommentar von Prof. Hubert Gindert
Der Artikel von Prof. Hubert Gindert beleuchtet die gegenwärtige Krise der katholischen Kirche in Europa und betont, dass ihr Überleben nur in missionarischen Gemeinschaften möglich ist. Während die Kirche in Afrika, Asien und möglicherweise Lateinamerika als Volkskirche bestehen bleibt, sieht die Situation in Europa düster aus.
Wichtigste Erkenntnis: Die katholische Kirche in Europa wird nur in missionarischen Gemeinschaften überleben können, da die traditionelle Volkskirche aufgrund eines tiefgreifenden Glaubensverlustes und einer spirituellen Krise schwindet.
Detaillierte Zusammenfassung
-
Epochenwechsel und spirituelle Krise: Tobias Haberl und Kardinal Robert Sarah beschreiben einen historischen Epochenwechsel, der Europa von einem christlichen zu einem
nichtchristlichen Kontinent verwandelt. Benedikt XVI. spricht von der größten spirituellen Krise seit dem Untergang des Römischen Reiches.
-
Rückgang der Gläubigkeit: Die Teilnahme an der sonntäglichen Eucharistiefeier in Deutschland ist seit 1950 drastisch gesunken. 1950 lag die Teilnahme bei 50,4%, 2023 nur noch
bei 4%.
-
Innere Herausforderungen: Die Kirche kämpft mit inneren Problemen, darunter der Synodale Prozess, der aufgrund sexueller Missbrauchsfälle initiiert wurde. Dieser Prozess hat
jedoch zu weiteren Spannungen und einer Spaltung innerhalb der Kirche geführt.
-
Verlust der kirchlichen Bindung: Eine repräsentative Untersuchung zeigt, dass nur noch 4% der Katholiken sich als „gläubig und kirchennah“ bezeichnen. Die Mehrheit der
Bevölkerung hat wenig bis keine religiöse Bindung.
-
Kritik an kirchlichen Führungskräften: Es wird kritisiert, dass die Bischöfe ihrer Verantwortung nicht gerecht wurden, das Evangelium treu und unermüdlich zu verkündigen und
die Gläubigen zu führen.
- Synodaler Irrweg: Der Synodale Prozess, der als Reaktion auf die Missbrauchsfälle gestartet wurde, hat zu einer weiteren Entfremdung der Gläubigen geführt. Die Teilnahme an der Eucharistiefeier ist während des Prozesses weiter gesunken.



erhöhtes Suizidrisiko nach Abtreibungen und Fehlgeburten
In einer kürzlich veröffentlichten Studie im Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology wurden 2.829 Frauen in den USA im Alter von 41 bis 45 Jahren auf ihre reproduktive Gesundheit und Suizidversuche untersucht. Die Ergebnisse sind erschütternd: Frauen, die Abtreibungen oder Fehlgeburten erlebt haben, haben doppelt so häufig Suizidversuche unternommen wie Frauen ohne solche Erfahrungen.
Besonders betroffen sind Frauen, die zu einer Abtreibung gedrängt wurden, mit einem Anteil von 46% an Suizidversuchen. Frauen, die Abtreibungen hinter sich haben, weisen einen Anteil von 35% auf, und Frauen, die ihre Babys durch Fehlgeburten oder Schwangerschaftskomplikationen verloren haben, haben einen Anteil von 30%. Im Vergleich dazu haben nur 13% der Frauen, die Kinder geboren, aber keine Abtreibungen oder Fehlgeburten erlebt haben, Suizidversuche unternommen.

Diese Zahlen verdeutlichen die immense psychische Belastung, die mit dem Verlust eines Kindes einhergeht. Mary Szoch vom Family Research Council betont, dass der Verlust eines Kindes eine große Belastung für Frauen darstellt und fordert mehr Untersuchungen zu den Auswirkungen auf die körperliche und seelische Gesundheit. Sie sieht die Ergebnisse der Studie als Motivation für den Schutz der Ungeborenen, der gleichzeitig ein Schutz für die Mütter ist.
Die Ergebnisse dieser Studie unterstreichen die Bedeutung des Schutzes des ungeborenen Lebens und der Unterstützung von Frauen in schwierigen Situationen. Es ist ein Aufruf an die Gesellschaft, sich für das Leben einzusetzen und Frauen in ihrer Not beizustehen. Die katholische Kirche bietet zahlreiche Hilfsprogramme und Beratungsdienste an, um Frauen in Krisensituationen zu unterstützen und ihnen Hoffnung und Trost zu spenden.
Möge diese Studie uns dazu inspirieren, uns noch stärker für den Schutz des Lebens und die Unterstützung von Frauen einzusetzen, die mit dem Verlust eines Kindes konfrontiert sind. Jeder Selbstmordversuch ist ein Schrei nach Hilfe, und als Gemeinschaft sind wir aufgerufen, diesen Hilferuf zu hören und darauf zu reagieren, im Geiste der Liebe und Barmherzigkeit, wie es Christus uns gelehrt hat.
Erziehung und Glaube: Die Verantwortung der Eltern

Viele Eltern stellen sich irgendwann die Frage: „Haben wir in der Erziehung unserer Kinder etwas falsch gemacht?“ Besonders dann, wenn sie feststellen, dass ihre erwachsenen Kinder keinen Bezug mehr zur Kirche oder zum Glauben haben. Religiöse Praktiken sind in vielen Familien kaum noch sichtbar, Gebete mit den Kindern gehören nicht zum Alltag, und auch die Feier der Sakramente wird häufig hinausgezögert.
Dieser Wandel führt bei vielen Eltern und Großeltern zu Unsicherheit und Selbstzweifeln. Doch woran liegt es, dass der Glaube in vielen Familien nicht mehr selbstverständlich weitergegeben wird?
Die Bedeutung des Vorbilds in der Erziehung
Kinder lernen durch Beobachtung. Sie nehmen wahr, wie Konflikte gelöst werden, ob Eltern schwierige Situationen aus einer christlichen Haltung heraus bewältigen und ob das Gebet eine Rolle im Familienleben spielt. Die Frage, ob der Glaube aktiv vorgelebt wurde, ist daher entscheidend.
Ein Beispiel hierfür findet sich in einer Erzählung des Neutestamentlers Gerhard Lohfink:
Ein achtjähriges Mädchen, Laura, möchte zur Erstkommunion gehen, ist aber nicht getauft. Ihre Eltern, beide Akademiker, lehnen eine religiöse Erziehung ab und möchten, dass ihr Kind erst mit 18 selbst entscheidet, ob es einer Kirche angehören möchte.
Doch stellt sich hier die Frage: Ist es wirklich eine freie Entscheidung, wenn das Kind nie die Möglichkeit hatte, den Glauben kennenzulernen?
«Erziehung» geschieht immer
Eltern können nicht verhindern, dass ihre Kinder durch ihr Umfeld geprägt werden. Werte und Überzeugungen werden in Kindergarten, Schule und Gesellschaft vermittelt – ob bewusst oder unbewusst.
Beispiele aus der Praxis zeigen, wie stark diese Einflüsse sein können. So haben etwa einige Eltern berichtet, dass ihre Kinder bereits im Vorschulalter mit bestimmten Begriffen oder Wertvorstellungen konfrontiert wurden, die sie zu Hause nicht kennengelernt hatten. Die zunehmende Digitalisierung bringt weitere Herausforderungen mit sich, etwa durch den Zugang zu ungefilterten Inhalten im Internet.
Wenn Eltern in anderen Bereichen – wie Sport, Musik oder Fremdsprachen – frühzeitig auf Förderung setzen, warum sollte dies nicht auch für den Glauben gelten? Die Vorstellung, dass Kinder erst im Erwachsenenalter eine bewusste Entscheidung für oder gegen den Glauben treffen können, setzt voraus, dass sie überhaupt eine Grundlage dafür haben.
Die Verantwortung der Glaubensweitergabe
Der christliche Glaube ist nicht nur eine persönliche Überzeugung, sondern auch eine Verantwortung, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. In der christlichen Tradition spielt die Glaubensweitergabe eine zentrale Rolle – sei es durch das gemeinsame Gebet, das Erzählen biblischer Geschichten oder das Feiern der Sakramente.
Ein Kind, das nie von Jesus gehört hat, kann ihn auch nicht kennenlernen. Ein Jugendlicher, der nie beten gelernt hat, wird es als Erwachsener kaum von selbst tun. Daher ist es wichtig, Kindern den Glauben nicht vorzuenthalten, sondern ihn als wertvolle Lebensmöglichkeit anzubieten.
Fazit
- Erziehung (auch durch das Umfeld) findet immer statt – Werte und Überzeugungen werden bewusst oder unbewusst vermittelt.
- Glaubensweitergabe ist keine Bevormundung, sondern ein Angebot, das Kindern die Möglichkeit gibt, sich bewusst für den Glauben zu entscheiden.
- Eine christliche Erziehung schafft Orientierung und gibt Kindern die Chance, in einer von vielen Einflüssen geprägten Welt Halt zu finden.
Wer den Glauben nicht vorlebt, kann nicht erwarten, dass er in der nächsten Generation weiterbesteht. Die Frage ist also nicht nur, ob man alles richtig gemacht hat, sondern vielmehr, ob man seinen Kindern überhaupt die Möglichkeit gegeben hat, den Glauben kennenzulernen.
Zu einem Kommentar über MAgnus Striet, Freiburg
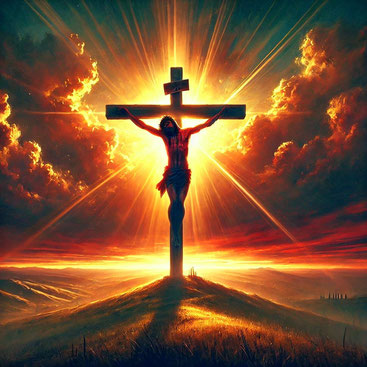
Um den Aspekt der Selbsthingabe Jesu und das Verständnis von Gottes Wesen als Liebe klarer zu betonen und durch passende Bibelstellen zu untermauern, möchte ich den Artikel von Dr. Lukas Matuschek weiterentwickeln. Der Schwerpunkt liegt auf der Darstellung von Jesu Selbsthingabe als Ausdruck seiner Liebe.
Liebe als Offenbarung Gottes in Jesus Christus
Dr. Matuschek trifft den zentralen Punkt: Gott hat sich in Jesus Christus nicht primär als der absolut Freie offenbart, sondern als der Liebende. Jesu Handeln, sein Leben und insbesondere sein Tod am Kreuz, zeigen, dass Gottes Wesen die Liebe selbst ist (1 Joh 4,8). Diese Liebe ist weder abstrakt noch unverbindlich, sondern konkret und opferbereit. Sie zeigt sich in der Ganzhingabe Jesu, der bereit war, sein Leben hinzugeben, um die Menschen zu retten.
Bibelstellen zur Liebe Jesu:
- Johannes 15,13: „Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde.“
Diese Stelle bringt die Hingabe Jesu als den höchsten Ausdruck von Liebe auf den Punkt. Die Liebe Jesu ist nicht nur ein Gefühl, sondern ein Tun, das bis zur Selbstaufopferung geht.
- Römer 5,8: „Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren.“
Paulus verdeutlicht hier, dass Gottes Liebe zu den Menschen unabhängig von ihrem Verdienst ist. Die Erlösung durch Jesu Tod geschieht aus Gnade und Liebe, nicht aus Zwang oder Notwendigkeit.
- Philipper 2,6-8: „Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen; er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz.“
Diese Stelle zeigt die radikale Selbsterniedrigung und Hingabe Jesu als Akt der Liebe. Der Gehorsam Jesu ist keine Unterwerfung, sondern ein Ausdruck seiner liebenden Einheit mit dem Willen des Vaters.
Die Kreuzesliebe:
Der Kreuzestod Jesu ist nicht nur ein historisches Ereignis, sondern das Herzstück des christlichen Glaubens, das die überfließende Liebe Gottes offenbart. Es war nicht „nötig“ im Sinne einer äußeren Notwendigkeit, sondern Ausdruck seiner inneren Entscheidung, die Menschen zu retten (Joh 3,16). Diese Liebe nimmt das Risiko der Ablehnung und des Scheiterns auf sich, bleibt aber bedingungslos.
Liebe als Weg zur Gemeinschaft mit Gott
Dr. Matuscheks These, dass es nicht die menschliche Freiheit, sondern die Liebe ist, die uns in Beziehung zu Gott bringt, wird in der Schrift bestätigt:
- 1 Johannes 4,19: „Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat.“
Unsere Antwort auf Gott gründet nicht in unserer Eigenleistung oder Freiheit, sondern in seiner vorausgehenden Liebe.
- Johannes 14,6: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich.“
Hier wird klar, dass die Gemeinschaft mit Gott allein durch die Person Jesu Christi und seine Liebe möglich ist.
- Epheser 2,8-9: „Denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet, nicht aus eigener Kraft – Gott hat es geschenkt.“
Auch diese Stelle betont, dass unsere Rettung allein durch die Gnade und Liebe Gottes geschieht.
Die Herausforderung der Liebe:
Die Liebe Gottes fordert eine Antwort. Sie ruft zur Umkehr, zur Demut und zur Hingabe. Dr. Matuschek bringt dies eindrucksvoll zum Ausdruck: Wahre Liebe verlangt, dass wir all das sterben lassen, was nicht liebt. Dieser Prozess kann schmerzhaft sein, ist aber notwendig, um in der Liebe Gottes zu wachsen.
Bibelstellen zur Reinigung durch die Liebe:
- 1 Petrus 1,22: „Reinigt eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit, damit ihr eine ungeheuchelte brüderliche Liebe habt.“
Die Liebe Gottes reinigt uns und befähigt uns, wahrhaft zu lieben.
- Matthäus 5,8: „Selig, die ein reines Herz haben; denn sie werden Gott schauen.“
Nur ein Herz, das in der Liebe Gottes gereinigt ist, kann Gott schauen und die Gemeinschaft mit ihm erfahren.
Der Artikel zeigt: Magnus Striet erkennt einen wichtigen Aspekt von Gottes Freiheit, überbetont diesen aber zulasten des zentralen Wesens Gottes, der Liebe. Die Freiheit Gottes ist keine Losgelöstheit, sondern eine Freiheit zur Liebe. Jesus Christus zeigt uns, dass wahre Liebe frei, aber nicht unverbindlich ist. Sie bindet sich, weil sie sich verschenkt. Der Weg zu Gott ist kein Akt autonomer Freiheit, sondern eine Gnade, die uns in der Liebe verwandelt.
Jesu Liebe bleibt das Zentrum der christlichen Botschaft – sie fordert heraus, heilt, und führt letztlich zum ewigen Leben bei Gott.
Hier geht es zu dem Kommentar bei kath.net
US-Wahl: ZEichen gegen "Woke" Politik und Abtreibung

Ein Kommentar von Roland Noé (kath.net)
Der Kommentar von Roland Noé auf kath.net feiert Donald Trumps Wahlsieg 2024 als Triumph für konservative Werte und gegen „woke“ Politik. Er sieht diesen Sieg als Erfüllung einer Prophezeiung und als Absage an den liberalen Journalismus und die Pro-Abtreibungspolitik der Demokraten. Laut Noé geht Trumps Erfolg mit einem kulturellen Wandel einher, in dem konservative Werte, wie sie etwa viele Katholiken vertreten, stärker Anerkennung finden.
Die fünf zentralen Punkte:
1. Erfüllte Prophezeiung und Symbol für Konservatismus
Noé sieht Trumps Wahlsieg als Bestätigung einer Prophezeiung von 2020 und als Zeichen für eine Rückkehr zu konservativen Werten, insbesondere im christlich-evangelikalen und katholischen Kontext.
2. Kritik an "Woke" Politik und Abtreibung
Der Kommentar kritisiert die liberalen Werte der Demokraten und hebt Trumps konservative Positionen hervor, die laut Noé im Einklang mit christlichen und moralischen Prinzipien stehen, insbesondere in Bezug auf Abtreibung.
3. Medienkritik an deutschsprachiger Berichterstattung
Noé kritisiert deutsche Medien, die seiner Meinung nach voreingenommen sind und die Wahl falsch dargestellt haben. Er wirft ihnen vor, ein verzerrtes Bild der politischen Stimmung in den USA zu vermitteln.
4. Stärkung von sozialen Netzwerken als alternative Informationsquelle
Der Kommentar hebt Plattformen wie X (ehemals Twitter) als verlässliche und aktuelle Informationsquellen hervor und lobt Elon Musks Einsatz für die Freiheit sozialer Medien während des Wahlkampfs.
5. Gewinner: Konservative und religiöse Werte
Noé sieht Katholiken und Abtreibungsgegner als große Gewinner der Wahl, da diese Gruppen in Trump und seinem Vize J.D. Vance wichtige politische Fürsprecher erhalten haben.
Frauenpriestertum - Warum Nicht?

Kurzzusammenfassung: Frauenpriestertum in der Kirche (Nach dem Youtube-Film von Prof. Dr. Nina Heeremann)
Historische Perspektive: Die Frage nach der Priesterweihe von Frauen ist seit dem zweiten Jahrhundert präsent. Theologen kamen zu dem Schluss, dass die Kirche keine Befugnis hat, das von Jesus Christus überlieferte Priesterbild zu ändern.
Jesus' Vorgehen: Obwohl Jesus revolutionäre Interaktionen mit Frauen pflegte, wählte er ausschließlich Männer als Apostel. Dies deutet darauf hin, dass das Priestertum bewusst an Männer gebunden wurde.
Biblische Begründung: Die Apostelgeschichte zeigt, dass das Apostelamt traditionell an Männer gebunden war, wie die Wahl des Nachfolgers für Judas demonstriert.
Sakramentale Zeichen: Die Kirche betont, dass die Sakramente, einschließlich der Priesterweihe, auf den von Christus festgelegten Zeichen basieren. So wie Wasser für die Taufe unerlässlich ist, bleibt das Priestertum an Männer gebunden, da Christus als Mann die sakramentale Realität verkörpert.
Würdigkeit und Geschlechterrolle: Die Würde der Frau wird in der Kirche hochgeachtet, insbesondere durch die Verehrung Marias. Das Priestertum bleibt jedoch Männern vorbehalten, um die von Christus bestimmte sakramentale Ordnung zu wahren.
Hätten sie es jemals gewagt, sich auf ähnliche Weise über den Islam lustig zu machen?"

Entsetzen bei Christen über die Beleidigung des Christentums bei der Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris - Scharfe Kritik von US-Bischöfen, der jüdischen Welt und der Politik - Auch Franz. Bischofskonferenz übt Kritik!
Vielen Christen reagieren mit Entsetzen auf die gestrige Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris. Bei der Eröffnungsfeier wurde das Letzte Abendmahl als Woke- LGBTQi-Transgender-Party
dargestellt und damit das Christentum offensichtlich ins Lächerliche gestellt. Der bekannte US-Bischof Robert Barron hat die Beleidigung in einem Video-Beitrag scharf kritisiert und die Frage
gestellt: "Hätten sie es jemals gewagt, sich auf ähnliche Weise über den Islam lustig zu machen?" Kritik gab es auch von Tesla- und X-Ceo Elon Musk: "Das war äußerst respektlos gegenüber
Christen."
Welt-Chefredakteur Ulf Poschardt meinte zur Christen-Verachtung auf X: "Wirklich aufregend wäre gewesen den Propheten Mohammed hier mal heiter zu verhöhnen. Aber im Elfenbeinturm wird nur Gratismut serviert, kein wirklicher Mut." Kritik kam auch aus der jüdischen Welt. Eli David, ein bekannt jüdischer Influencer, meinte auf X: "Sogar als Jude bin ich wütend über diese ungeheuerliche Beleidigung von Jesus und dem Christentum ... Wie stehen Sie als Christen dazu?" Und US-Senator Tim Scott meinte dazu nur: "Abscheulich".
Raymond Arroyo, der bekannte katholische US-Journalist, meinte auf X zu der Vorstellung: "Die Eröffnungszeremonie der #Olympiade hätte ohne den Beigeschmack eines Sakrilegs vielleicht einen Tick inklusiver ausfallen können. Welche anderen religiösen Persönlichkeiten werden verspottet? Wurden die Olympischen Spiele nicht geschaffen, um die globale Einheit zu fördern? Wie fördert die Beleidigung der größten Religion der Welt dieses Ziel?" Und die katholische Medien-Website Visegrád 24 mit 1 Million X-Followern fragt auf X: "Warum besteht die LGBTQia+-Community, die sich für Liebe, Frieden und Toleranz einsetzt, darauf, Christen zu beleidigen?"
28.07.2024
Quelle: kath.net
Meine Einschätzung:
Die Darstellung der Heiligen Eucharistie bei der Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris hat eine breite Welle der Empörung ausgelöst. Diese Provokation könnte jedoch als unfreiwilliges Eingeständnis gesehen werden: Indem die Eucharistie verspottet wird, wird gleichzeitig ihre Bedeutung und Heiligkeit anerkannt. Es ist gerade diese Reaktion, die darauf hinweist, dass Jesu in der Eucharistie real präsent ist. Eine solche emotionale und kontroverse Reaktion zeigt, dass das Sakrament der Eucharistie nicht nur ein symbolischer Akt ist, sondern eine Realität, die selbst durch Spott und Kritik nicht entkräftet werden kann.
Bischof Meier: Weniger Sitzungen - Mehr Seelsorge

"Bei Eurer Weihe wurden Eure Hände gesalbt, nicht Euer Sitzfleisch! Ihr wurdet nicht zum Priester geweiht, um Eure Zeit in endlosen Sitzungen zu verbringen."
Hier sind die wichtigsten Punkte aus der Predigt von Bischof Bertram Meier:
- Fokus auf Seelsorge: Priester sollten weniger Zeit in Verwaltungsaufgaben und mehr Zeit in der Seelsorge und im Kontakt mit Menschen verbringen.
· Realität des Priesterlebens: Das Leben eines Priesters ist hart und unromantisch, ähnlich dem eines Hirten, der sich um seine Herde kümmert.
· Kritik annehmen: Kritik an Priestern ist wichtig und kann helfen, sie wachzurütteln und zu verbessern.
· Authentizität: Priester sollten eine persönliche Beziehung zu Jesus pflegen und authentisch sein, anstatt vorgefertigte Texte zu wiederholen.
Anbetung
Anbetung als grundlegende Haltung des Staunens vor Gott. Anbetung ist ein Wachstumsprozess, der dazu führt, dass der Mensch seine Abhängigkeit von Gott anerkennt und ihm total vertraut. Das vollkommene Ja zu Gott in Anbetung bringt Freiheit und ermöglicht göttliches Handeln durch uns. Die Anbetung ist nicht nur Lobpreis, Dankgebet oder Bitte, sondern eine Haltung des totalen Vertrauens, auch wenn man Gottes Handeln nicht immer versteht. Diese Anbetung führt zu innerem Frieden, Freude und Liebe sowie zur Fähigkeit, andere durch Evangelisation zu beeinflussen. Anbetung ist die Voraussetzung für geistliches Wachstum und das Erleben der Früchte des Geistes. Es wird ermutigt, Anbetung nicht nur im Wort, sondern auch im täglichen Leben zu praktizieren.
Kraftloses Beten
Das Gebet ist eine der wichtigsten und schönsten Möglichkeiten, mit Gott in Verbindung zu treten. Durch das Gebet können wir Gott loben und danken, ihm unsere Anliegen und Nöte mitteilen, ihn um Vergebung und Hilfe bitten, ihn um seinen Willen und seine Führung fragen. Das Gebet ist ein Ausdruck unseres Glaubens und unserer Liebe zu Gott.
Aber nicht jedes Gebet ist kraftvoll und wirksam. Die Bibel zeigt uns, dass es Bedingungen gibt, die unser Gebet beeinträchtigen oder sogar verhindern können.
Deswegen werde ich die Kirche verlassen (Reflexion)
In diesem kurzen Dialog geht es darum, dass ein junger Mann dem Pfarrer mitteilt, dass er die Kirche verlassen will, weil er dort negative Dinge beobachtet hat, wie Klatsch, Unstimmigkeiten und Ablenkungen während des Gottesdienstes. Der Pfarrer gibt ihm den Rat, sich auf ein mit Wasser gefülltes Glas zu konzentrieren und drei Runden durch die Kirche zu drehen, ohne Wasser zu verschütten. Nachdem der junge Mann dies erfolgreich tut, stellt der Pfarrer fest, dass er währenddessen die negativen Dinge in der Kirche nicht wahrgenommen hat. Der Pfarrer erklärt, dass genauso im Leben, wenn der Fokus auf Jesus Christus liegt, man weniger die Fehler der Menschen um einen herum sehen wird. Der Schlusspunkt lautet, dass jemand, der die Kirche wegen der Menschen verlässt, sie möglicherweise nie wegen Jesus betreten hat.
Duales System der Schweiz - weltweit einzigartig
Die katholische Kirche in der Schweiz kennt als einzige katholische Kirche der Welt zwei gleichgestellte Führungslinien.
Die pastorale Linie sorgt sich um Gottesdienste und die Seelsorge, die staatskirchenrechtliche Linie besorgt nach Artikel 6 Nr. 1 der Verfassung der Landeskirche Nidwalden «die der kirchlichen Tätigkeit dienende öffentliche Verwaltung.»
Gelebte Ökumene
Verhaltenskodex im Bistum Chur

Der Verhaltenskodex ist inzwischen zu einer "Empfehlung" bzw. "Orientierung" eingestuft worden. Den allgemein angesprochenen Bedenken hinsichtlich der Widersprüchlichkeit und Kollision einzelner Normen innerhalb des Kodex mit anderen bestehenden Rechtsvorschriften wurde somit Rechnung getragen.
so erreicht man mich
Seit Februar 2021 bin ich Pfarrer in der Pfarrei Hergiswil am See, Nidwalden (NW).
Stephan Schonhardt, Dorfplatz 15, CH-6052 Hergiswil am See
Sekretariat: +41 (0) 41 632 42 22
Direkt: +41 (0) 41 632 42 25
Deutschland: Stephan Schonhardt, Postfach 1101, D-79803 Dogern
Sämtliche Fotos sind entweder selbst aufgenommen, von KI erstellt oder der Webseite www.pixabay.com entnommen.